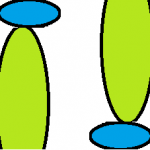 Die jenseitige Himmelsperspektive
Die jenseitige Himmelsperspektive
Eine Impulsfrage zu Beginn einer Religionsstunde in einer 5. Klasse lautet: „Was ist für dich Himmel?“ Die Antworten der 14- bis 16-Jährigen sind fast durchgehend eindeutig in eine bestimmte Richtung. „Himmel, das ist dort, wo wir nach dem Tod hinkommen.“ „Himmel ist ein Leben nach dem Tod.“ „Über den Himmel können wir nichts wissen, weil noch niemand dort war.“ Fast automatisch geht beim Nachdenken über diese Frage der Blick nach oben. Wie ein starker Magnet ziehen die Gedanken an den Himmel weg von dieser Welt, weg von den eigenen Erfahrungen, weg von der Klasse, vom Freundeskreis oder der Familie, weg von der Empirie und hin zur Spekulation, die als Glaube definiert wird. Der Himmel wird assoziiert mit etwas, das nicht von dieser Welt sei, als Andersort, dort drüben, wo der bereits verstorbene Urgroßopa nun auf irgendeine unbekannte Art weiterleben kann.
„Schaut nicht empor!“ Die biblische Perspektive nach unten
Die klassische Himmelfahrtsdarstellung finden wir in der Apostelgeschichte, als deren Autor Lukas gilt, wobei sich hinter diesem Namen ein Autorinnenkollektiv verbirgt, das um das Jahr 80 herum die eigenen Gemeindeerfahrungen legendarisch wiedergab. Die Legende über die Himmelfahrt ist voll von mythologischen Bildern. Nicht nur Schülerinnen und Schüler sind zunächst geneigt, solche Berichte wie einen Zeitungsartikel zu sehen, was dazu führt, dass der ganze Bericht als unglaubwürdiges Hokuspokus abgetan wird. Wer den Text nicht metaphorisch versteht, missversteht ihn. Wer den Himmel als „sky“ und nicht als „heaven“ versteht, blickt nach oben und nicht in sein Herz und seine Umgebung und nicht auf Menschen, die ihm oder ihr viel bedeuten. In der Apostelgeschichte ist die Rede von einer Wolke, in die Jesus aufgenommen wird. Es ist kein meteorologisches Phänomen, sondern jene Wolke, die auch dem Volk Israel beim Exodus durch die Wüste den Weg gezeigt hat. Gott als Wolke. Da ist die Rede von zwei Männern in weißen Gewändern. Es sind nicht reale menschliche Wesen, sondern Engel als mythologische Kunstgestalten, die bereits den Frauen am Auferstehungstag am leeren Grab begegnet sind und stets die Gegenwart des Göttlichen verstärken. Und dann kommt die Aufforderung dieser Engel, nicht mehr hinaufzublicken, sondern den radikalen Perspektivenwechsel vorzunehmen. „Schaut nicht empor, der Herr ist hier bei uns …“, heißt es in einem der neuen Lieder, die längst alt geworden sind. Die Aussage ist bleibend gültig.
Dafür steht das ganze Leben Jesu und seine Botschaft. Jesus hat die eschatologischen Bilder nicht abgeschafft, sondern auf die richtige Ebene gehoben, im Hegelschen Sinne also „aufgehoben“. Gott ist ein Gott der Lebenden. Als ihn die Sadduzäer, die die Auferstehung leugneten, danach fragten, war Jesus ganz klar. Für ihn gilt die Reich-Gottes-Wirklichkeit, wo Frauen sich nicht mehr dem Joch ungerechter Gesetze beugen müssen und nicht mehr an Männer gebunden werden – ob sie wollen oder nicht. Dort ist Auferstehung, wo es solche unterdrückerischen Gesetze nicht mehr gibt. Nicht in einem „Drüben“, sondern im Hier und Heute. Jesus hebt in seiner Antwort letztlich die Zeitstruktur von Heute und Morgen auf und betont die Jetztzeit als jene Zeit, die zählt. Jesus hat die Kranken nicht mit einer Aussicht auf morgen vertröstet, sondern sie geheilt. In seinen Gleichnissen spricht er von den Senfstauden, die jetzt zu sprießen beginnen, vom Sauerteig, der jetzt schon den Brotleib verändert oder vom Schatz im Acker, der jetzt schon behoben wird. Weil Jesus nicht mehr vertröstet hat, wurde er zum Ärgernis für die Mächtigen, die keine Veränderung wollten.
In diesem Sinne sind die mythologischen Bilder von Gericht, Fegefeuer und Himmel primär Aussagen für ein Hier und Jetzt. Jesus denkt und handelt in den Dimensionen der Gottesherrschaft und des Königreiches Gottes – das aus Respekt vor dem Gottesnamen als Himmelreich genannt wurde. Damit wird freilich deutlich: Es geht stets darum, in dieser Welt Gerechtigkeit und Frieden spürbar werden zu lassen und Ungerechtigkeiten und Unfrieden zu beseitigen. Das hat mit Himmel zu tun.
Diese Perspektive finde ich in vielen Varianten und Variationen bei Philosophinnen und Philosophen, in literarischen oder filmischen Werken. Goethe lässt Faust wie folgt sinnieren:
„Nach drüben ist die Aussicht uns verrannt;
Tor, wer dorthin die Augen blinzelnd richtet,
Sich über Wolken seinesgleichen dichtet!
Er stehe fest und sehe hier sich um;
Dem Tüchtigen ist diese Welt nicht stumm.
Was braucht er in die Ewigkeit zu schweifen!
Was er erkennt, läßt sich ergreifen.
Er wandle so den Erdentag entlang;
Wenn Geister spuken, geh‘ er seinen Gang,
Im Weiterschreiten find‘ er Qual und Glück,
Er, unbefriedigt jeden Augenblick!“
Soeben wurde an den 200. Geburtstag von Karl Marx gedacht. Der Philosoph aus Trier hat prägnant die aufklärerische Kritik formuliert und die Projektionsthese von Feuerbach gesellschaftskritisch aufgenommen. Wenn der Himmel zu einer jenseitigen Kategorie wird, dann ist er Vertröstung für die verarmten Massen und nimmt ihnen das revolutionäre Potenzial. So konnte auch bereits Heinrich Heine spitz formulieren: „Den Himmel überlassen wir den Spatzen und den Pfaffen.“ Doch ist die klassenlose Gesellschaft nicht vielmehr ein anderes Wort für „Himmel“? Könnte nicht die diesseitige Himmelsperspektive die destruktiven Kräfte des Kapitalismus bändigen?
Protoytpisch ist sicherlich der Film von Kay Pollak „Wie im Himmel“. Menschen in einem schwedischen Dorf, die auf unterschiedliche Weise die Sehnsucht nach einem geglückten Leben in sich tragen, zugleich aber daran gehindert werden, gedemütigt werden, von einem gesetzesstrengen Pfarrer mit dem Jenseits abgespeist werden, entdecken durch Gemeinschaft und Solidarität Wege der Befreiung und des Neubeginns in diesem konkreten Leben. Dieser Befreiungsweg gipfelt in „Gabriella’s Song“, wo es heißt: „Hab vom Himmel ein Stück gesehen. Ich will spüren, dass ich lebe. Ich will leben, glücklich sein, so wie ich bin, offen mutig stark und frei. Die Zeit hier geht so schnell vorbei. Ich will wachsen, staunen über diese Welt. Und den Himmel, an den ich glaube, den gibt es! Ich will spüren, dass ich mein Leben lebe. Den werd ich finden. Ich will sagen: ja, ich hab gelebt!“
In diesem Film gibt es eine geniale Parallele zur Himmelfahrtsgeschichte Jesu. Im Finale des Filmes stirbt Daniel, während sein Chor gerade auf den großen Auftritt wartet. Doch können sie ohne ihren Dirigenten Daniel singen? Er kann nicht mehr kommen. Dann ist es gerade der Behinderte, der sich in seiner Verzweiflung traut, den Ton vorzugeben. Alle stimmen ein, nicht nur der Chor, sondern das ganze Auditorium beginnt zu singen. Daniel ist gestorben, doch zugleich ist er in ihrer Mitte. Sie haben gelernt zu leben und zu lieben auch ohne ihn. So kann selbst schwerer Abschied gelingen. Jesus entschwindet den Blicken der Jüngerinnen und Jünger und weiß: Sie schaffen es nun ohne seine leibliche Gegenwart, in seinem Namen weiterzumachen, zu verkünden und zu heilen, sich dafür einzusetzen, dass die Himmel auf Erden Wirklichkeit werden können und die Höllen verschwinden.
Leibliche Aufnahme in den Himmel als religionenübergreifendes Narrativ
In allen christlichen Kirchen ist das Fest Christi Himmelfahrt seit dem Konzil von Nicäa im Jahr 325 fester Bestandteil des Glaubens geworden. Seither heißt es auch im Glaubensbekenntnis: „aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten des Vaters, …“ So eint dieses Bekenntnis die vielen christlichen Kirchen. Wenn die Rede ist von der „leiblichen Aufnahme“, so will dies unterstreichen, dass in Abgrenzung zu gnostisch-stoischen Philosophien die Achtsamkeit der ganzen Person – und daher auch des Leibes – gelten muss. Ohne Bezugnahme auf die leibliche Natur, den Körper, mit all dem, was zu ihm gehört, wesentlich auch die Sexualität, gibt es keinen Himmel! Jede Leibfeindlichkeit ist daher unchristlich. Wieder könnten wir auf den Film „wie im Himmel“ verweisen, wo protestantisch verbrämte Prüderie als Irrweg karikiert wird. Wegen dieser Hochachtung des Leiblichen gegenüber wurde einige Jahrhunderte später das Dogma von der „leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel“ verkündet.
Der religionenübergreifende Charakter des Himmelfahrtsmythos wird dadurch deutlich, dass es bereits im frühen Judentum eine Himmelfahrtsgeschichte gibt. Im 2. Buch der Könige 2,1-18 können wir über die Himmelfahrt des Elia lesen. In diesem Zusammenhang gibt er die prophetischen Aufgaben an Elisa weiter. Für Muslime wiederum ist die Midrasch, die Himmelfahrt des Propheten Muhammad, ein zentraler Bestandteil des Glaubens. In mehreren Suren im Koran wird seine Himmelfahrt unterschiedlich beschrieben. Ein Ort der Himmelfahrt des Propheten Muhammad wird gleich wie im Christentum am Ölberg gesehen. Ein Stück Himmel, so können wir wohl heute sagen, ist dort, wo sich die abrahamitischen Religionen in Frieden begegnen, weil sie erkennen, wie nahe sie sich sind.
Klaus Heidegger, Zum Fest Christi Himmelfahrt 2018, www.klaus-heidegger.at
